Die Besetzung einer Stelle ist heute mehr als nur die Auswahl des passenden Kandidaten. Im modernen Recruiting zählen Kennzahlen, Prozesse und Kosten – allen voran die Time-to-Hire. In diesem Artikel erfahren Arbeitgeber, warum diese Kennzahl entscheidend ist und wie sie den Bewerbungsprozess gezielt beeinflusst.
Was ist Time-to-Hire? - Definition
Die Time-to-Hire bezeichnet den Zeitraum, der zwischen dem ersten Kontakt mit einem Bewerber und der Unterzeichnung des Arbeitsvertrags vergeht. Sie ist eine der wichtigsten Recruiting-Kennzahlen, da sie den Erfolg und die Effizienz Ihres Recruiting-Prozesses messbar macht.
Shiftbase-Tipp: Als digitale HR-Software hilft Shiftbase dabei, Prozesse im Bewerbermanagement zu strukturieren, Zeiten transparent zu erfassen und Recruiting-Kosten zu senken – inklusive Time-to-Hire-Auswertungen.
Was ist der Unterschied zwischen Time-to-Hire und Time-to-Fill?
Viele verwechseln diese beiden Kennzahlen:
-
Time-to-Hire: Zeitraum ab Kontakt mit dem Bewerber bis zur Vertragsunterzeichnung.
-
Time-to-Fill: Zeitraum von der Veröffentlichung der vakanten Stelle bis zur endgültigen Besetzung.
Beispiel: Wenn Sie eine Stelle am 1. Mai ausschreiben, sich ein Kandidat am 10. Mai bewirbt und am 20. Mai den Vertrag unterschreibt, dann beträgt:
-
Time-to-Fill = 19 Tage
-
Time-to-Hire = 10 Tage
Warum ist eine kurze Time-to-Hire für Unternehmen entscheidend?
Eine kurze Time-to-Hire ist nicht nur ein Zeichen für effizientes Recruiting, sondern ein klarer Wettbewerbsvorteil – besonders in einem angespannten Arbeitsmarkt, in dem Talente umkämpft sind. Arbeitgeber, die schnell und strukturiert agieren, besetzen nicht nur offene Positionen zügiger, sondern verbessern auch ihre Candidate Experience, sparen Kosten und stärken ihre Arbeitgebermarke.
5 Gründe, warum eine kurze Time-to-Hire entscheidend ist:
1️⃣ Top-Kandidaten schneller sichern
Qualifizierte Bewerber haben meist mehrere Optionen. Dauert Ihr Prozess zu lange, entscheidet sich der Kandidat womöglich für die Konkurrenz. Geschwindigkeit wirkt hier wie ein Commitment-Signal.
Studien zeigen: Bewerber springen bei einem zu langen Einstellungsprozess bis zu 60 % häufiger ab.
2️⃣ Kosten für Vakanzen minimieren
Je länger eine Stelle unbesetzt bleibt, desto höher sind die verdeckten Kosten – etwa durch Produktivitätsausfälle, Überstunden oder Umsatzverluste. Eine effiziente Time-to-Hire reduziert diese Verluste messbar.
3️⃣ Mitarbeiterzufriedenheit im Team sichern
Unbesetzte Positionen bedeuten oft Mehrbelastung für bestehende Teams. Das kann zu Frustration und Überforderung führen – mit negativen Folgen für die Mitarbeiterbindung.
4️⃣ Candidate Experience verbessern
Ein schlanker, klar strukturierter Bewerbungsprozess hinterlässt Eindruck – auch bei Bewerbern, die sich gegen Ihr Unternehmen entscheiden. Eine positive Erfahrung kann zukünftige Bewerbungen oder Empfehlungen fördern.
5️⃣ Arbeitgeberattraktivität stärken
Unternehmen mit klaren Abläufen und kurzen Entscheidungswegen gelten als professionell, modern und agil. Das ist besonders wichtig für die Außenwirkung in Branchen mit starkem Fachkräftemangel.
Wie berechnet man die Time-to-Hire?
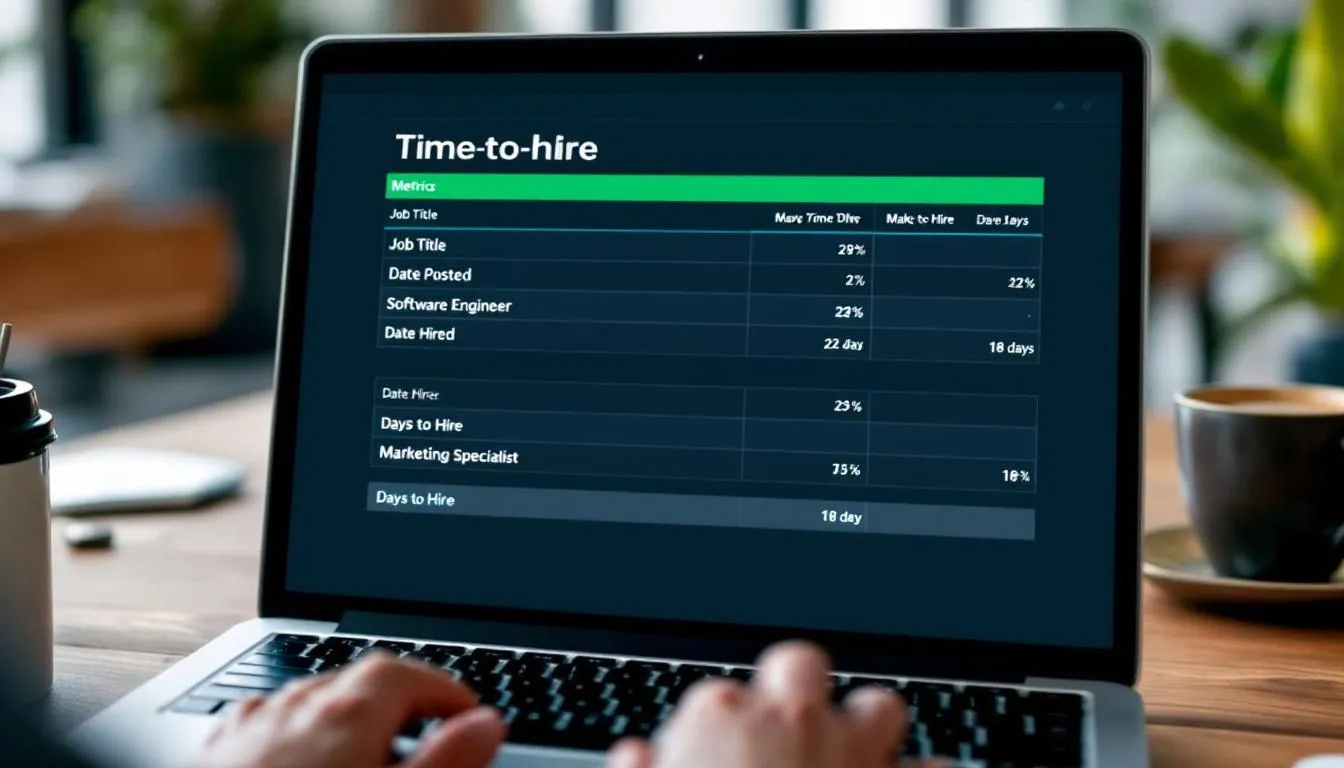
Die Time-to-Hire ist eine wichtige Recruiting-Kennzahl, mit der Arbeitgeber messen können, wie effizient ihr Einstellungsprozess abläuft. Sie zeigt den Zeitraum an, der zwischen dem ersten Kontakt mit einem Bewerber und der Unterzeichnung des Arbeitsvertrags vergeht.
Die Formel ist einfach:
Time-to-Hire = Datum der Vertragsunterzeichnung – Datum der Bewerbung
Beispiel:
Ein Kandidat bewirbt sich am 10. Juni. Der Arbeitsvertrag wird am 25. Juni unterzeichnet.
→ Time-to-Hire = 15 Tage
Alternativ kann auch gelten:
-
Startpunkt = Datum des Bewerbungseingangs
-
Endpunkt = Datum der finalen Entscheidung oder Vertragsunterzeichnung
Was genau als Start- und Endpunkt zählt, hängt vom internen Recruiting-Prozess Ihres Unternehmens ab. Wichtig ist: die Definition muss einheitlich sein, um vergleichbare Kennzahlen zu erhalten.
Welche Faktoren beeinflussen die Time-to-Hire?
Die Time-to-Hire ist mehr als nur eine einfache Zahl – sie ist das Ergebnis zahlreicher interner und externer Einflüsse. Wenn Sie die Recruiting-Kennzahl wirklich optimieren wollen, sollten Sie die wichtigsten Einflussfaktoren kennen.
1. Komplexität der Position
Je höher die Anforderungen an eine Stelle (z. B. IT-Fachkraft, Management-Position), desto länger dauert meist der Auswahlprozess. Fachspezifische Anforderungen und mehrere Interviewrunden verlängern die Besetzungszeit.
2. Struktur und Effizienz des Recruiting-Prozesses
Manuelle Prozesse, fehlende Automatisierung oder unklare Zuständigkeiten verzögern Entscheidungen. Ein strukturiertes Bewerbermanagement beschleunigt den Ablauf deutlich.
3. Anzahl der Interviewrunden
Jedes zusätzliche Interview verlängert die Time-to-Hire. Oft entstehen Verzögerungen durch die Koordination von Terminen zwischen Bewerbern, Fachabteilungen und HR.
4. Interne Abstimmungsprozesse
Langsame Entscheidungsfindung – etwa wegen unterschiedlicher Meinungen zwischen Hiring Manager und Geschäftsführung – kann die Time-to-Hire signifikant verlängern.
5. Verfügbarkeit von Recruitern und HR-Ressourcen
Wenn die Personalabteilung überlastet ist oder nicht genug Ressourcen zur Verfügung stehen, verlangsamt sich der Einstellungsprozess.
6. Qualität und Reichweite der Stellenanzeige
Wenn die Stellenausschreibung unklar formuliert oder auf den falschen Kanälen veröffentlicht wurde, dauert es länger, bis passende Bewerber gefunden werden – was die Time-to-Hire nach hinten verschiebt.
7. Saisonalität und Marktbedingungen
Zu bestimmten Zeiten (z. B. Sommer, Jahreswechsel) bewerben sich weniger Kandidaten. Auch ein angespannter Arbeitsmarkt erschwert die schnelle Stellenbesetzung.
Welche Kosten entstehen in der Time-to-Hire?

Während sich die Time-to-Hire auf die Dauer des Recruiting-Prozesses konzentriert, sind die Kosten, die in diesem Zeitraum entstehen, mindestens genauso relevant für Arbeitgeber. Eine lange Time-to-Hire kann schnell teuer werden – sowohl direkt als auch indirekt.
🔍 Direkte Kosten in der Time-to-Hire
Diese lassen sich meist klar beziffern:
Recruiting-Kosten
-
Schaltung von Stellenanzeigen auf Jobportalen
-
Nutzung von Recruiting-Dienstleistern oder Headhuntern
-
Kosten für Bewerbermanagement-Software
Personalkosten im HR-Bereich
-
Arbeitszeit von Recruitern, Hiring Managern und Personalverantwortlichen
-
Aufwand für Kommunikation, Interviews und Auswahlprozesse
Kosten pro Vorstellungsgespräch
-
Reisekosten der Kandidaten
-
Bewirtung, ggf. Aufwandsentschädigungen
-
Interne Zeitressourcen für Vor- und Nachbereitung
🚨 Indirekte Kosten bei langer Time-to-Hire
Diese sind schwerer messbar – aber oft noch folgenreicher:
Produktivitätsverlust
-
Offene Stellen bleiben unbesetzt → das Team muss Aufgaben kompensieren
-
Verzögerungen in Projekten, Servicequalität leidet
Mehrbelastung der Mitarbeiter
-
Höheres Stressniveau und potenzielle Überstunden im Team
-
Gefahr von Unzufriedenheit und erhöhter Fluktuation
Verpasste Umsätze
-
Besonders im Vertrieb, Kundenservice oder produktionsnahen Bereichen: keine Mitarbeiter = keine Leistung = kein Umsatz
Negative Candidate Experience
-
Langwierige Prozesse schrecken Bewerber ab
-
Schlechter Ruf des Unternehmens auf dem Arbeitsmarkt
Time-to-Hire Benchmark in Deutschland
Die Time-to-Hire variiert in Deutschland stark je nach Branche, Unternehmensgröße und Position. Dennoch gibt es zuverlässige Benchmark-Werte, die Arbeitgebern als Orientierung dienen können – vor allem, um die eigene Recruiting-Kennzahl im Wettbewerb einzuordnen.
Durchschnittliche Time-to-Hire in Deutschland
Laut Daten der Bundesagentur für Arbeit und einschlägiger Studien liegt die durchschnittliche Time-to-Hire in Deutschland bei:
🔹 24 bis 42 Tage – vom Bewerbungseingang bis zur Vertragsunterzeichnung
(Quelle: StepStone Recruiting-Studien, IAB, Bundesagentur für Arbeit)
Diese Werte schwanken je nach Sektor:
| Branche | Ø Time-to-Hire (Tage) |
|---|---|
| IT & Technik | 35–45 Tage |
| Gesundheit & Pflege | 30–40 Tage |
| Vertrieb & Marketing | 25–35 Tage |
| Gastronomie & Einzelhandel | 15–25 Tage |
| Öffentlicher Dienst | 40–60 Tage |
Wovon hängt der Benchmark ab?
-
Komplexität der Position (Führungskraft vs. operative Rolle)
-
Wettbewerbsdruck am Arbeitsmarkt
-
Digitale Reife des Bewerbungsprozesses
-
Einsatz von HR-Software und Automatisierung
⚠️ Warum der Vergleich wichtig ist
Wenn Ihre Time-to-Hire deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt, drohen:
-
Bewerberabsprünge
-
Höhere Recruiting-Kosten
-
Verpasste Geschäftschancen durch unbesetzte Stellen
Fazit: Time-to-Hire als Schlüsselkennzahl im Recruiting
Die Time-to-Hire ist weit mehr als nur eine Zahl – sie ist ein zentraler Indikator für die Effizienz Ihres Recruiting-Prozesses und ein direkter Hebel zur Senkung von Kosten, Verbesserung der Candidate Experience und zur Stärkung Ihrer Arbeitgebermarke.
Unternehmen, die ihre Time-to-Hire kontinuierlich messen und optimieren, gewinnen nicht nur schneller qualifizierte Mitarbeiter, sondern positionieren sich auch langfristig erfolgreich am Arbeitsmarkt.
Häufig gestellte Fragen
-
Nein, Führungspositionen oder hochspezialisierte Jobs haben meist eine längere Time-to-Hire als einfache operative Stellen.
-
Erfassen Sie die Zeitpunkte von Bewerbungseingang bis Vertragsunterzeichnung – am besten automatisiert mit einer HR-Software.
-
Bewerbermanagement-Systeme bieten Funktionen zur Prozessautomatisierung und Kennzahlen-Tracking.
-
Verlust von Bewerbern, steigende Recruiting-Kosten, sinkende Wettbewerbsfähigkeit am Arbeitsmarkt.
-
Ja, sie vermittelt Bewerber und bietet Beratung, beschleunigt aber nicht automatisch interne Prozesse – hier ist Ihre Organisation gefragt.


